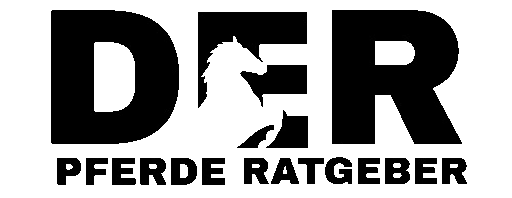Magengeschwüre sind bei Pferden ein weit verbreitetes Problem, das oft unterschätzt wird. Man schätzt, dass bis zu 90 % der Rennpferde und über 60 % der Freizeitpferde betroffen sind. Diese schmerzhaften Läsionen in der Magenschleimhaut können die Lebensqualität eines Pferdes erheblich beeinträchtigen und von subtilen Leistungseinbrüchen bis zu schweren Koliken und Verhaltensänderungen führen. Doch leider bleiben die Symptome oft unerkannt oder werden fehlinterpretiert, was eine frühzeitige Diagnose und Behandlung erschwert.
Dieser umfassende Leitfaden taucht tief in das Thema Magengeschwüre beim Pferd ein. Wir beleuchten die komplexen Ursachen, die oft mit modernen Haltungs- und Fütterungspraktiken zusammenhängen, zeigen Ihnen, wie Sie die vielfältigen Symptome – von unspezifischen Anzeichen bis hin zu deutlichen Schmerzäußerungen – erkennen können, und erklären die diagnostischen Möglichkeiten. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über die Behandlungsoptionen und, noch wichtiger, über präventive Maßnahmen und das langfristige Management, um das Risiko eines Wiederauftretens zu minimieren. Unser Ziel ist es, Ihnen das nötige Wissen an die Hand zu geben, um Ihr Pferd vor diesem „stillen Leiden“ zu schützen und ihm ein schmerzfreies und gesundes Leben zu ermöglichen.
Der Pferdemagen: Ein sensibles Organ und seine Herausforderungen
Um Magengeschwüre zu verstehen, ist ein Blick auf die einzigartige Anatomie und Physiologie des Pferdemagens unerlässlich. Der Magen des Pferdes ist im Vergleich zu seiner Körpergröße relativ klein (Fassungsvermögen etwa 8-15 Liter) und darauf ausgelegt, kontinuierlich kleine Futtermengen zu verarbeiten.
Er besteht aus zwei Hauptbereichen:
- Drüsenloser Teil (Pars non-glandularis): Dieser obere Teil, auch als Kardia-Region oder Plattenepithelbereich bekannt, ist ungeschützt und besonders anfällig für Magensäure. Hier entstehen die meisten Magengeschwüre (etwa 80 %).
- Drüsenhaltiger Teil (Pars glandularis): Dieser untere Teil produziert kontinuierlich Magensäure (Salzsäure) zur Verdauung und ist durch eine schützende Schleimschicht (Mukosa) und Bikarbonat besser vor der aggressiven Säure geschützt. Geschwüre in diesem Bereich sind seltener, aber oft schwerwiegender.
Das Hauptproblem ist die kontinuierliche Produktion von Magensäure. Im Gegensatz zu uns Menschen, die nur bei Nahrungsaufnahme Säure produzieren, produziert der Pferdemagen 24 Stunden am Tag Säure – bis zu 30 Liter täglich. Die Natur hat dies so vorgesehen, da Pferde in freier Wildbahn fast ununterbrochen Gras fressen. Das Kauen von Raufutter stimuliert die Speichelproduktion, und Speichel enthält Bikarbonat, das als natürlicher Puffer die Magensäure neutralisiert. Eine volle Magenfüllung, insbesondere mit Raufutter, bildet zudem eine schützende „Futtermatte“ über dem drüsenlosen Bereich.
Moderne Haltungspraktiken stehen oft im Widerspruch zu dieser natürlichen Physiologie. Lange Fresspausen, Stress, Getreidefütterung und intensive Bewegung können das empfindliche Gleichgewicht stören und zur Entstehung von Magengeschwüren beitragen.
Ursachen von Magengeschwüren: Ein multifaktorielles Problem
Magengeschwüre beim Pferd (Equine Gastric Ulcer Syndrome – EGUS) entstehen aus einem Ungleichgewicht zwischen schützenden und aggressiven Faktoren in der Magenschleimhaut. Die Hauptursachen sind oft eine Kombination aus:
1. Fütterungsmanagement:
- Lange Fresspausen: Wenn Pferde über längere Zeit (länger als 4-6 Stunden) kein Raufutter zur Verfügung haben, bleibt der Magen leer, aber die Säureproduktion läuft weiter. Ohne Futter und Speichel als Puffer greift die Säure die ungeschützte Schleimhaut an. Dies ist die häufigste Ursache bei Freizeitpferden.
- Zu wenig Raufutter: Eine zu geringe Menge an Raufutter führt zu zu kurzen Kauzeiten und damit zu unzureichender Speichelproduktion.
- Hoher Getreideanteil/Stärke: Stärkereiche Futtermittel (Hafer, Gerste, Mais) produzieren bei der Verdauung im Magen flüchtige Fettsäuren, die die Magensäure weiter erhöhen und die Schleimhaut reizen können. Zudem reduzieren sie die Kautätigkeit im Vergleich zu Raufutter.
- Qualität des Raufutters: Staubiges oder schimmeliges Heu kann Stress für den Verdauungstrakt bedeuten und das Risiko erhöhen.
- Futterumstellungen: Plötzliche oder häufige Futterwechsel können den Magen-Darm-Trakt belasten.
2. Stress:
Stress ist ein massiver Faktor für die Entstehung von Magengeschwüren. Pferde sind Fluchttiere und reagieren sehr sensibel auf Stressoren.
- Sozialer Stress: Streit in der Herde, Wechsel von Boxennachbarn, Isolation oder Integration in eine neue Gruppe.
- Transportstress: Reisen, Turniere, Klinikaufenthalte.
- Training und Leistungssport: Intensives Training, insbesondere auf nüchternen Magen, erhöht den Druck auf den Magen und kann die Magensäure in den ungeschützten Bereich spritzen lassen. Bei Bewegung wird die Säure zudem stärker verwirbelt.
- Umweltstress: Laute Geräusche, häufiger Wechsel der Umgebung, zu wenig Auslauf.
- Schmerzen/Krankheit: Chronische Schmerzen oder andere Erkrankungen (z.B. Lahmheiten, Koliken) setzen den Körper unter Stress und beeinflussen die Magenschleimhaut.
3. Medikamente:
- Nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAIDs): Medikamente wie Phenylbutazon („Bute“), Flunixin-Meglumin oder Meloxicam, die häufig bei Schmerzen und Entzündungen eingesetzt werden, können als Nebenwirkung die schützende Magenschleimhaut schädigen und Magengeschwüre auslösen oder verschlimmern. Dies ist besonders bei längerer Anwendung oder hohen Dosen der Fall.
4. Haltung und Bewegung:
- Boxenhaltung: Pferde in reiner Boxenhaltung haben oft zu lange Fresspausen und zu wenig Bewegung, was zu Langeweile, Stress und somit zu Magengeschwüren führen kann.
- Intensives Training auf nüchternen Magen: Erhöht das Risiko deutlich.
- Wenig Weidegang: Gras enthält neben Fasern auch natürliches Bikarbonat und fördert kontinuierliches Fressen.
5. Andere Faktoren:
- Alter: Fohlen sind besonders anfällig für Magengeschwüre (oft durch Stress, Medikamente oder das Absetzen).
- Grunderkrankungen: Pferde, die bereits an anderen Krankheiten leiden, haben ein erhöhtes Risiko.
- Individuelle Veranlagung: Manche Pferde scheinen von Natur aus empfindlicher zu sein.
Symptome von Magengeschwüren: Das „stille Leiden“ erkennen
Die Symptome von Magengeschwüren sind oft unspezifisch und können leicht mit anderen Problemen verwechselt werden. Dies macht die Diagnose so schwierig. Pferde sind Meister im Verbergen von Schmerzen. Achten Sie auf subtile, aber anhaltende Veränderungen im Verhalten oder in der Leistung.
Verhaltensänderungen:
- Müdigkeit, Apathie, Lethargie: Das Pferd wirkt matt, lustlos, weniger aufmerksam.
- Reizbarkeit, Aggressivität: Besonders beim Putzen, Gurten (Gurtzwang), Berühren der Bauchgegend oder Füttern.
- Zähneknirschen: Oft ein deutliches Zeichen für Schmerzen.
- Gähnen, Leerkauen: Kann auf Übelkeit oder Unwohlsein hindeuten.
- Flehe-Stellung/Kolikanzeichen: Leichtes Flehmen, häufiges Hinlegen und Aufstehen, Rücken aufwölben, in sich zusammensacken, manchmal leichte Koliksymptome, die immer wiederkehren.
- Appetitmangel/Futterselektion: Das Pferd frisst sein Kraftfutter nicht auf, lässt Heu liegen, sortiert bestimmte Futtermittel aus. Manchmal fressen sie Heu, verschmähen aber Kraftfutter.
- Verändertes Trinkverhalten: Weniger oder mehr trinken.
Leistungsbezogene Symptome:
- Leistungsabfall: Das Pferd ist nicht mehr so energisch, reagiert langsamer, zeigt weniger Ausdauer.
- Rittigkeitsprobleme: Widersetzlichkeit gegen den Schenkel, Verwerfen, Kopfschlagen, Unwilligkeit sich biegen oder versammeln zu lassen, Buckeln oder Steigen beim Angaloppieren oder bei Übergängen.
- Gurtzwang: Empfindlichkeit beim Gurten, Ohrenanlegen, Beißen, Aufblähen des Bauches.
- Muskelabbau: Trotz ausreichender Futteraufnahme kein Muskelaufbau oder sogar Abbau, da Nährstoffe nicht optimal verwertet werden.
Körperliche Symptome:
- Schlechtes Haarkleid: Struppiges, glanzloses Fell.
- Gewichtsverlust: Trotz ausreichender Futtermenge nimmt das Pferd ab oder hält sein Gewicht nicht.
- Wiederkehrende, leichte Koliken: Oft nach Futteraufnahme oder in Stresssituationen.
- Durchfall/Kotwasser: Insbesondere bei Geschwüren im hinteren (drüsenhaltigen) Teil des Magens.
- Blut im Kot (selten sichtbar): Dunkler, teerartiger Kot (Meläna) bei schweren Blutungen, aber meist nur bei massiven Blutungen zu sehen.
Wichtig: Wenn Sie eines oder mehrere dieser Symptome bemerken, insbesondere wenn sie neu auftreten oder sich verschlimmern, sollten Sie den Verdacht auf Magengeschwüre haben und Ihren Tierarzt kontaktieren.
Diagnose von Magengeschwüren: Der Goldstandard und Alternativen
Die eindeutige Diagnose von Magengeschwüren beim Pferd ist oft eine Herausforderung, da die Symptome so unspezifisch sind.
1. Gastroskopie (Magenendoskopie): Der Goldstandard
- Was ist das? Eine Gastroskopie ist die einzige Methode, die eine definitive Diagnose ermöglicht. Dabei wird ein flexibles Endoskop, das mit einer Kamera ausgestattet ist, über die Nüstern und die Speiseröhre in den Magen eingeführt. Der Tierarzt kann so die gesamte Magenwand visuell beurteilen, die Anzahl, Größe und Schwere der Geschwüre feststellen und ihren genauen Ort lokalisieren.
- Vorbereitung: Das Pferd muss vor der Gastroskopie 12-16 Stunden nüchtern sein (kein Futter, Wasser kann bis kurz vor der Untersuchung angeboten werden), damit der Magen leer ist und eine gute Sicht möglich ist.
- Ablauf: Das Pferd wird leicht sediert, um es ruhig zu stellen und das Einführen des Endoskops zu erleichtern.
- Vorteile: Präziseste Diagnose, ermöglicht die Klassifizierung der Geschwüre und die Überwachung des Therapieerfolgs.
2. Symptomatische Therapie (Diagnose ex juvantibus):
- Was ist das? Bei dieser Methode wird, wenn eine Gastroskopie nicht möglich oder gewünscht ist, eine Therapie mit magensäurehemmenden Medikamenten eingeleitet. Verbessern sich die Symptome des Pferdes deutlich, wird dies als indirekter Beweis für das Vorhandensein von Magengeschwüren gewertet.
- Vorteile: Weniger invasiv und kostspielig als eine Gastroskopie.
- Nachteile: Keine definitive Diagnose, keine Aussage über Art, Lage und Schweregrad der Geschwüre. Andere Ursachen für die Symptome könnten übersehen werden. Der Therapieerfolg kann nicht visuell kontrolliert werden.
3. Kot-/Blutuntersuchungen (eingeschränkt aussagekräftig):
- Blutwerte: Können unspezifische Entzündungszeichen oder Blutarmut bei starken Blutungen zeigen, aber keine Geschwüre nachweisen.
- Kotuntersuchung auf okkultes Blut: Kann auf Blutungen im Verdauungstrakt hinweisen, aber Blut kann auch aus anderen Bereichen stammen, und viele Magengeschwüre bluten nicht stark genug, um nachweisbar zu sein.
- Keine sichere Diagnosemethode!
Empfehlung: Der Goldstandard ist die Gastroskopie. Auch wenn sie aufwendiger ist, bietet sie die einzige Gewissheit und ermöglicht eine gezielte und effektive Behandlung.
Behandlung von Magengeschwüren: Medikamente und Management
Die Behandlung von Magengeschwüren basiert auf zwei Säulen: der medikamentösen Therapie zur Heilung der Geschwüre und dem Management der Ursachen zur Verhinderung eines Wiederauftretens.
1. Medikamentöse Therapie:
Das wichtigste Medikament zur Behandlung von Magengeschwüren ist Omeprazol.
- Omeprazol: Ein Protonenpumpenhemmer (PPI), der die Produktion von Magensäure blockiert. Er ist das am besten erforschte und wirksamste Medikament zur Behandlung und Prävention von Magengeschwüren beim Pferd. Es wird in der Regel einmal täglich oral als Paste oder Granulat verabreicht.
- Heilungsphase: Eine hohe Dosis wird über einen Zeitraum von 4-6 Wochen verabreicht.
- Erhaltungs-/Prophylaxedosis: Nach der Heilung kann eine niedrigere Dosis zur Vorbeugung eingesetzt werden, insbesondere bei Risikopferden (Turnierpferde, stressanfällige Pferde).
- Wichtig: Es gibt verschiedene Präparate. Verwenden Sie nur solche, die speziell für Pferde zugelassen sind, da menschliche Präparate nicht ausreichend bioverfügbar sind.
- Antazida: Medikamente, die die Magensäure direkt neutralisieren (z.B. Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid). Sie wirken nur kurzzeitig und sind eher zur Symptomlinderung als zur Heilung geeignet, können aber unterstützend wirken.
- Schleimhautschutzmittel: Sucralfat bildet einen schützenden Film über den Geschwüren und fördert die Heilung. Wird oft zusätzlich zu Omeprazol eingesetzt, insbesondere bei Geschwüren im drüsenhaltigen Bereich.
- H2-Rezeptor-Antagonisten: (z.B. Ranitidin, Cimetidin) Blockieren die Histaminrezeptoren, die die Säureproduktion anregen. Wirken weniger stark als Omeprazol und müssen mehrmals täglich verabreicht werden.
2. Fütterungsmanagement während der Therapie:
- Raufutter ad libitum: Ununterbrochener Zugang zu hochwertigem, staubarmem Heu ist während der Therapie und darüber hinaus entscheidend. Dies fördert die Speichelproduktion und puffert die Magensäure.
- Heu vor Kraftfutter: Immer zuerst Heu füttern, bevor Kraftfutter gegeben wird. Dies bildet eine schützende Heumatte im Magen.
- Zucker- und Stärkereduktion: Kraftfutter auf ein Minimum reduzieren oder ganz weglassen. Wenn Kraftfutter nötig ist, auf stärkearme Alternativen (z.B. Luzerne, unmelassierte Rübenschnitzel, spezielle Magen-Müslis) umsteigen.
- Futter auf mehrere kleine Mahlzeiten verteilen: Statt weniger großer Portionen.
- Wasser: Ständiger Zugang zu frischem, sauberem Wasser.
3. Haltungs- und Stressmanagement:
- Reduktion von Stressoren: Identifizieren und minimieren Sie Stressfaktoren. Dies kann bedeuten:
- Optimierung der Herdenzusammenstellung.
- Mehr Auslauf und Sozialkontakt.
- Vermeidung von Übertraining.
- Ruhige Umgebung im Stall.
- Minimierung von Transporten und Klinikaufenthalten.
- Regelmäßige Bewegung: Angepasste, leichte Bewegung fördert die Durchblutung und reduziert Stress, sollte aber nicht auf nüchternen Magen erfolgen.
- Weidegang: Wenn möglich, bietet Weidegang (kontrolliert) eine ideale, kontinuierliche Raufutteraufnahme.
4. Ergänzungsfuttermittel (Unterstützend):
Es gibt zahlreiche Magenzusatzfuttermittel auf dem Markt. Diese können die Therapie unterstützen und zur Prophylaxe beitragen, ersetzen aber keine medikamentöse Behandlung im akutem Fall. Beispiele sind Produkte mit:
- Pektin und Lecithin: Bilden eine schützende Schicht auf der Magenschleimhaut.
- Algenkalk, Magnesiumoxid, Natriumbikarbonat: Wirken als Puffer, um Magensäure zu neutralisieren.
- Slippery Elm (Ulmenrinde), Aloe Vera: Können beruhigend auf die Schleimhaut wirken.
- Probiotika/Präbiotika: Zur Unterstützung der Darmflora, da Magengeschwüre oft mit einer gestörten Darmflora einhergehen.
Wichtig: Besprechen Sie die Auswahl von Ergänzungsfuttermitteln immer mit Ihrem Tierarzt.
Langzeitmanagement und Prävention: Magengeschwüren vorbeugen
Nach erfolgreicher Behandlung ist das Langzeitmanagement entscheidend, um ein Wiederauftreten der Magengeschwüre zu verhindern. Die Prävention basiert auf einer konsequenten Optimierung von Fütterung, Haltung und Stressmanagement.
1. Fütterungsstrategien zur Prävention:
- Raufutter, Raufutter, Raufutter!: Bieten Sie Ihrem Pferd so viel Raufutter (Heu, Weidegras) wie möglich an, idealerweise ad libitum (unbegrenzt) oder mit engmaschigen Fresspausen von maximal 4 Stunden. Heunetze mit kleineren Maschen können die Fressdauer verlängern.
- Raufutter vor Kraftfutter: Gewöhnen Sie sich an, immer zuerst Heu zu füttern, bevor das Pferd Kraftfutter bekommt.
- Stärke- und Zuckerarme Fütterung: Reduzieren Sie den Anteil an Getreide und zuckerreichen Futtermitteln. Nutzen Sie stattdessen faserreiche Alternativen oder spezielle magenschonende Müslis. Eine Heuanalyse ist hier Gold wert, um den tatsächlichen Zuckergehalt Ihres Heus zu kennen.
- Futterqualität: Achten Sie auf hygienisch einwandfreies, staub- und schimmelfreies Raufutter.
- Wasser: Ständiger Zugang zu frischem, sauberem Wasser ist essenziell.
2. Haltungsoptimierung:
- Genug Auslauf und Sozialkontakt: Offenstallhaltung oder Gruppenhaltung mit ausreichend Platz und Rückzugsmöglichkeiten reduziert Stress erheblich.
- Reduzierung von Langeweile: Beschäftigungsmöglichkeiten im Stall und Paddock (z.B. Knabberhölzer, Spielbälle) können Fresspausen überbrücken und Langeweile reduzieren.
- Feste Routine: Pferde sind Gewohnheitstiere. Eine feste Tagesroutine bei Fütterung, Bewegung und Ruhezeiten kann Stress reduzieren.
3. Stressmanagement:
- Individuelle Stressoren identifizieren: Beobachten Sie Ihr Pferd genau, um herauszufinden, was es stresst (z.B. dominante Pferde in der Herde, laute Geräusche, zu viele Veränderungen).
- Vermeidung unnötiger Reisen: Transporte und Turnierstress können durch vorbeugende Gabe von Omeprazol gemindert werden.
- Angepasstes Training: Vermeiden Sie Übertraining und zu intensives Training auf nüchternen Magen. Bei Sportpferden kann eine kleine Portion Heu oder Luzerne vor dem Training helfen.
- Umgang: Ruhiger und konsequenter Umgang durch alle Bezugspersonen.
4. Überlegter Medikamenteneinsatz:
- Wenn NSAIDs über längere Zeiträume eingesetzt werden müssen, besprechen Sie mit Ihrem Tierarzt präventive Maßnahmen wie die gleichzeitige Gabe von Omeprazol.
5. Regelmäßige tierärztliche Kontrolle:
- Auch nach erfolgreicher Behandlung und Symptomfreiheit kann eine wiederholte Gastroskopie sinnvoll sein, um den Heilungserfolg zu überprüfen und bei Risikopferden präventiv zu agieren.
Magengeschwüre bei Fohlen: Ein besonderes Augenmerk
Magengeschwüre sind auch bei Fohlen, insbesondere in den ersten Lebensmonaten, ein häufiges und oft übersehenes Problem.
- Ursachen bei Fohlen: Stress durch Geburt, Krankheit, Trennung von der Mutter, Transport, Medikamentengabe (NSAIDs), aber auch zu wenig Futteraufnahme bei kranken Fohlen.
- Symptome bei Fohlen: Weniger Saugen, Kolikanzeichen (Bauchschmerzen, Aufblähen), Zähneknirschen, Rückenbogen, Liegen auf dem Rücken, Durchfall, schlechte Gewichtszunahme.
- Diagnose & Behandlung: Ähnlich wie bei erwachsenen Pferden, aber oft noch dringlicher. Omeprazol ist auch hier das Mittel der Wahl.
Fazit: Aufmerksam sein und proaktiv handeln
Magengeschwüre beim Pferd sind ein komplexes Problem, das eine umfassende Betrachtung von Haltung, Fütterung und Stressmanagement erfordert. Die oft unspezifischen Symptome machen die Diagnose schwierig, weshalb die Aufmerksamkeit des Pferdebesitzers für Verhaltensänderungen und die Gastroskopie als Goldstandard der Diagnose von entscheidender Bedeutung sind.
Die gute Nachricht ist: Magengeschwüre sind behandelbar und, was noch wichtiger ist, durch proaktives Management oft vermeidbar. Indem Sie die Fütterung optimieren, Fresspausen minimieren, Stress reduzieren und die Haltungsbedingungen an die natürlichen Bedürfnisse Ihres Pferdes anpassen, können Sie das Risiko erheblich senken. Seien Sie wachsam, hören Sie auf Ihr Pferd und scheuen Sie sich nicht, bei Verdacht professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Investition in die Magengesundheit Ihres Pferdes ist eine Investition in seine gesamte Lebensqualität und sein Wohlbefinden.